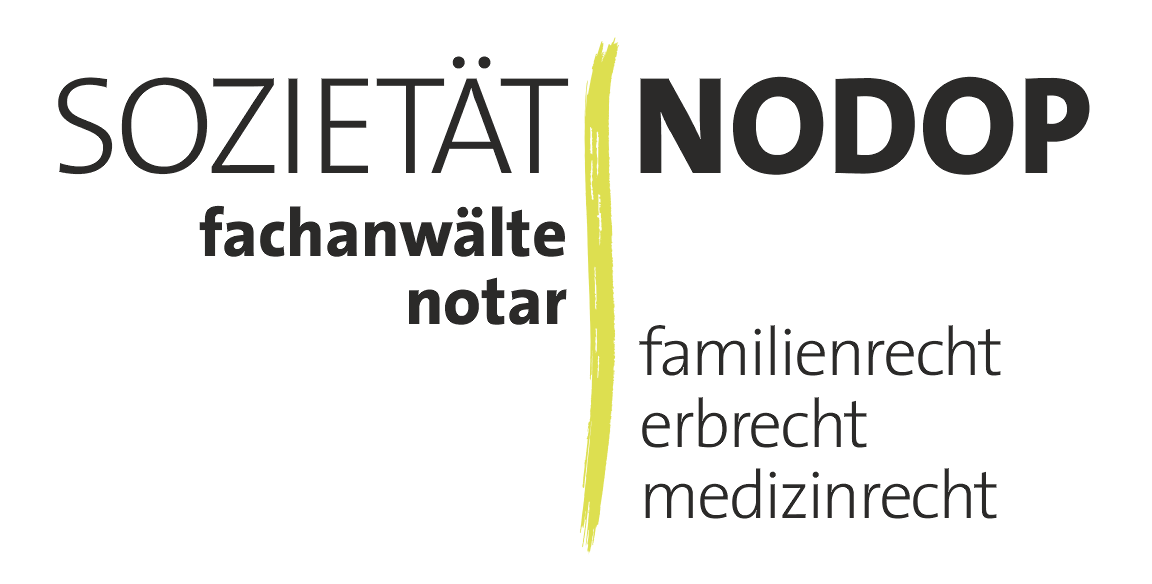Ärztliche Aufklärungspflicht: OLG Karlsruhe spricht Eltern Schadensersatz zu
In einem aufsehenerregenden Urteil hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe am 19. Februar 2020 entschieden, dass Eltern ein Schadensersatzanspruch zusteht, wenn Ärzte ihre Aufklärungspflicht über mögliche schwere Behinderungen eines ungeborenen Kindes verletzen. Das Urteil (Az.: 7 U 139/16) bezieht sich auf einen Fall, in dem die Eltern eines Kindes mit einer Balkenagenesie nicht ausreichend über die Risiken informiert wurden, die mit dieser Diagnose verbunden sind.
Hintergrund des Falls
Die Kläger, ein Ehepaar, hatten sich während der Schwangerschaft in die Obhut einer spezialisierten Klinik begeben, um mögliche Schädigungen ihres ungeborenen Kindes frühzeitig zu erkennen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde eine Balkenagenesie diagnostiziert, die mit weiteren Auffälligkeiten wie einer Falxhypoplasie und einem Hydrocephalus einherging. Die Ärzte versäumten es jedoch, die Eltern realistisch über die Möglichkeit einer schweren Behinderung aufzuklären.
Entscheidung des Gerichts
Das OLG Karlsruhe stellte fest, dass die Ärzte ihre Pflichten aus dem Behandlungsvertrag verletzt haben, indem sie die Eltern nicht ausreichend über die Risiken informierten. Der Senat war überzeugt, dass die Mutter bei Kenntnis der möglichen Behinderung die Schwangerschaft abgebrochen hätte. Aufgrund dieser Pflichtverletzung sprach das Gericht der Mutter ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zu. Zudem wurden den Eltern Schadensersatz für den Betreuungs- und Barunterhalt sowie für den Pflegemehraufwand zugesprochen.
Bedeutung des Urteils
Dieses Urteil unterstreicht die Bedeutung der ärztlichen Aufklärungspflicht in der pränatalen Diagnostik. Ärzte müssen werdende Eltern umfassend über mögliche Risiken informieren, damit diese eine fundierte Entscheidung über den Fortgang der Schwangerschaft treffen können. Das Urteil könnte weitreichende Auswirkungen auf die Praxis der pränatalen Beratung haben und setzt einen klaren Standard für die Aufklärungspflichten von Ärzten.
Das Urteil des OLG Karlsruhe ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rechte von Eltern in der pränatalen Diagnostik und könnte als Präzedenzfall für ähnliche Fälle in der Zukunft dienen.
- Aufrufe: 2082